Die Vergesellschaftung des Mehrwerts: Jaron Laniers Vorschlag einer neuen Netzpolitik
Alles, was es im „Netz“ zu finden gibt, geht zurück auf menschliche Leistung. Diese Leistungen bestehen einerseits aus Inhalten, die irgendwer „ins“ Netz gestellt hat, andererseits aus der Praxis der Netznutzung durch die User: Suchen und Kaufen bei Amazon, mit Bekannten (und weniger Bekannten) kommunizieren und sich austauschen bei facebook, Informationen suchen bei Google und so fort. Das Netz, wie wir es nutzen, ist – kann man sagen – Menschenwerk, es ist nicht das Werk von Programmen, Algorithmen oder technischen Artefakten. Die allermeisten der das Netz erst zum Leben erweckenden Leistungen werden indes kostenlos erbracht: als Tausch von Nutzungsmöglichkeiten gegen Nutzungspraktiken, deren Spuren als Daten von den Anbietern der Netzplattformen eingesammelt und vermarktet werden. Die Kommunikation der Leute wird in Geld umgewandelt, die Leistung der Vielen wird durch die Organisationskompetenz der Wenigen abgesaugt und – als big data – weiterverarbeitet und verkauft. Der Clou dabei ist: Die Vielen beteiligen sich aus freien Stücken, eben weil die Geldmaschine sauber kaschiert als hierarchiefreie, allen zugängliche Plattform erscheint, sich zu vernetzen, zu „liken“, sich mit Neuigkeiten zu versorgen und hie und da auch den Aufstand zu proben. Nötig ist dazu nur, den allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Software-Anwendungen zuzustimmen.
So zeichnet ein Kenner den gegenwärtigen Zustand des Netzes: Jaron Lanier, Informatiker, Musiker, „Internetphilosoph“, „digitaler Humanist“ und Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2014 montiert in seinem Buch „Wem gehört die Zukunft“ (2014, englische Originalausgabe 2013) die großen Utopie und die große Dystopie des Netzes zu einer düsteren Gegenwartsdiagnose: die horizontale Freiheit des Netzes sich zu vereinen wird durch die Kontrolle Aller durch Datenkraken und deren Geschäftsbedingungen nicht einfach korrumpiert, sie wird durch diese erst möglich. Freiheit und Kontrolle verhalten sich dabei zueinander wie Ideal- und Realfaktoren: Einerseits die Illusio der demokratischen, postkapitalistischen Vernetzung Aller mit Allen, andererseits deren Steuerung und Ausbeutung durch die Monopolisten der digitalen Vernetzungsplattformen. Was uns Lanier damit sagen will ist dies: Die sozialen Möglichkeiten des Netzes und die Ausbeutung durch big data stehen in einem symbiotischen Verhältnis, das eine ist ohne das andere nicht (mehr) zu haben. An dieser Symbiose scheitern alle Versuche, die informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen zu sichern, ohne der Funktionalität des Netzes irreparablen Schaden zuzufügen. Es ist so wie in Tolkiens Herr der Ringe: der Ring der Macht und der dunkle Herrscher sind eins.
Was ist zu tun? Laniers Vorschlag besticht durch seine Schlichtheit: Wenn das Funktionieren des Netzes davon abhängt, das wir, die Nutzerinnen und Nutzer, es durch unsere Tätigkeit füttern, dann müssen die Datengiganten für unsere Arbeit am Netz bezahlen. Fas alles bleibt, wie es ist: Die Unternehmen dokumentieren unser Online-Handeln weiterhin. Wir nutzen die dafür von den Unternehmen zur Verfügung gestellten „Sirenenserver“ und kommunizieren so, wie wir es wollen, suchen das, was wir wissen wollen und wählen die Produkte aus, die wir haben wollen. Aber: Jede unserer Handlungen, die in den Fängen der Server zu weiteren Verarbeitung hängen bleibt, wird – nun nicht mehr implizit, sondern explizit – mit einem Urheberschaftsvermerk versehen und löst eine Mikrozahlung an die Autorin oder den Autor aus. Aus einer asymmetrischen, ja, regelrecht sittenwidrigen Geschäftsbeziehung wird eine symmetrische Beziehung zwischen Urheber und Zweitverwerter.
Lanier ist sich natürlich bewusst, dass sein Vorschlag unter denen, die ein Interesse an der Rückeroberung des Internet aus den Fängen der Konzerne haben, auf wenig Gegenliebe stoßen dürfte: Denn im intellektuellen Milieu konzentriert sich die Kritik an den Verhältnissen auf die Kritik am Mangel an freier Verfügung über die eigenen Daten. Die Kontrolle der Informationen durch ihre kapitalistische Verwertung gilt vielen Internetkritikern als digitaler Sündenfall – und die Herauslösung des Zugangs zum Weltwissen aus den Fesseln des Eigentums als die große Chance des Netzes. Wir wissen, dass es anders gekommen ist, und Lanier fordert daher nicht die Revolution, sondernd eine marktkonforme Innovation. Der Kapitalismus des Digitalen soll nicht abgeschafft werden, sondern im Gegenteil durch die Stärkung der Stellung der MarktbürgerInnen gegen Monopolbildung und Ausbeutung geschützt werden. Deshalb ist Laniers Vorschlag es wert, sorgfältig geprüft zu werden. Man wird dann auch die darin eingebaute List der Vernunft zu würdigen wissen: die abschreckende Wirkung der Sozialisierung der Gewinne, die vielleicht den Appetit der Datenkraken zu zügeln vermag; die Öffnung der politischen Debatte um die Lenkung der Mikroerlöse aus den Netzbeiträgen, die ja nicht notwendig immer und überall an die einzelnen NutzerInnen fließen müssen; schließlich die Möglichkeit umverteilender Maßnahmen, die mit der Besteuerung solcher „Veräußerungsgewinne“ von persönlichen Informationen qua Online-Handeln einhergehen würden.
Zugegeben: Die beiden letztgenannten Möglichkeiten sind nicht Teil des Lanierschen Programms. Aber sie wären denkbar. Sie bildeten eine logische Entwicklungsmöglichkeit, die von den wirtschaftlichen Freiheitsrechten über die Entstehung politischer Beteiligungsrechte und schließlich zum Ausbau sozialer Bürgerrechte im Netz schrittweise entfaltet werden könnte. Dieser Dreischritt in genau dieser Reihenfolge bildet, so die einflussreiche Untersuchung Thomas H. Marshalls (Bürgerrechte und soziale Klassen), die Grundlage des Gelingens unserer modernen Wohlfahrtsgesellschaften. Warum sollte, was einmal geklappt hat, nicht wieder funktionieren?
- Weblog von Matthias Klemm
- Anmelden um Kommentare zu schreiben
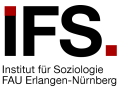
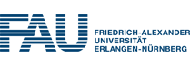


Facebook sozialiseren! Über
Facebook sozialiseren! Über neue Grenzziehungen im Netz
von Frank Adloff
Jaron Lanier hat in Matthias Klemm einen kongenialen Verteidiger seiner Hauptforderungen gefunden. Dabei ist die Logik beider bestechend: Das Internet ist sowieso kaputt, die Hoffnungen auf hierarchiefreie Vernetzungen, auf kapitalismusfreie Kommunikation und auf Kontrolle über die eigenen Daten wurden enttäuscht. Der einzig verbliebene, gangbare Weg ist uns Nutzer und Nutzerinnen des Internets zu Tauschpartnern der großen Plattformen wie Facebook, Amazon und Google zu machen. Wenn sie uns schon durch Big Data finanziell massiv ausbeuten, da wir bereit sind, uns zu offenbaren, unseren Interessen nachzugehen, miteinander zu kommunizieren, dann sollten wir an ihrem Verdienst ein klein wenig partizipieren dürfen: in Form von Mikrozahlungen.
Doch was bieten wir eigentlich den Netzplattformen an? Ist es wirklich ein Tausch, oder geht es nicht um Kommunikation, die (zumindest oft oder manchmal) auf Freiwilligkeit, Unentgeltlichkeit, vielleicht sogar Ästhetik, Politik und Selbstdarstellung setzt? Wenn wir fortan auf Facebook miteinander kommunizieren, gibt es nicht nur den Dritten, der davon profitiert. Die Marktlogik des Dritten wird unsere werden: Jeder kommunikative Akt, sprich jeder Klick, jede Zeile, die wir schreiben, gerät in den Sog instrumenteller Motive. Was wird es mir monetär bringen, welchen Spin muss ich einer (Selbst)Darstellung geben, damit ich ökonomisch etwas einfahren kann? Was uns droht, ist die Dystopie der totalen Inwertsetzung kommunikativer Akte.
Diese Landnahme vormals marktfreier Räume reiht sich natürlich ein in die Geschichte kapitalistischer Landnahmen, und wir sind vielleicht schon so sehr daran gewöhnt, dass diese Dystopie den meisten wohl kaum als eine solche erscheinen wird. Doch was wäre damit gelöst? Matthias Klemm hält eine Symmetrie zwischen Konzernen und Internetusern für möglich. Den Kontrollverlust über unsere Daten wird diese Symmetrie allerdings nicht verhindern, im Gegenteil: Sie wird ihn legitimieren und zementieren.
Aber immerhin könnte dies Szenario nicht – wie Lanier mehrfach in seinem Buch hervorhebt – die Mittelschichten und sogar gleich auch den gesamten Kapitalismus retten? Denn ohne Mikrozahlungen würden beide, so Lanier, in der kommenden Gratisökonomie zugrunde gehen. Hier zeigt sich in der digitalen Welt der gleiche Tanz um das goldene Kalb Wachstum wie in der analogen Welt. Ein Wachstum an Daten und Informationen ist immer besser! Wie wir uns auf die wahrscheinlich kommende Postwachstumsgesellschaft einstellen könnten, dazu finden wir kein Wort beim Internetvisionär Lanier. Warum nicht Jeremy Rifkins Vision einer postkapitalistischen Null-Grenzkosten-Gesellschaft einfach mal dagegen halten?
Postwachstum als Gesellschaftskonzept wird kommen müssen angesichts der realen Bedrohung globaler Erderwärmung. Was wäre das netzpolitische Pendant zur Erdwärmung? Evgeny Morozov schrieb im Januar 2014 in Slate: „Perhaps it’s the gradual evaporation of the democratic spirit from our political system.“ Marktbasierte Lösungen können in der Welt des Internets genauso wenig den Verlust an Öffentlichkeit, Demokratie, freier nicht-utlitaristischer Kommunikation stoppen wie der Neoliberalismus der letzten 35 Jahre dies nicht im Analogen vermochte. So wie Gesellschaft nicht allein tausch- und warenförmig zu organisieren ist, so auch nicht das Netz. Marktlösungen müssen flankiert werden durch staatliche und zivilgesellschaftliche Räume.
Warum dann das Internet als homogenen Raum betrachten? In der analogen Gesellschaft gelten doch, je nach Handlungssphäre, auch ganz unterschiedliche Werte und Gerechtigkeitsprinzipien. Die Kunst der Trennung in „Sphären der Gerechtigkeit“ (Michael Walzer) müsste auch im Netz vollzogen werden. So sind manche Austauschformen auf direkten Kontakt zwischen User und einem Unternehmen angelegt – hier kann eine Symmetrisierung über Mikrozahlungen sinnvoll sein. Wenn aber eine Plattform wie Facebook primär der freien Kommunikation von Peers dient, warum sollte diese den Geschmack von Ware, Instrumentalität und monetärem Tausch annehmen?
Warum nicht Facebook sozialisieren? Handelt es sich nicht mittlerweile um ein Gemeingut? Dann müsste sich Facebook entweder mit einer geringen monatlichen Nutzungsgebühr zufrieden geben und auf den Verkauf von Big Data verzichten, oder – falls das nicht funktioniert – könnte es auch Washington, D.C. verstaatlichen (zugegeben: ich fange an zu fantasieren). Die Wikipedia – ein anderes Beispiel – hat es geschafft, sich zivilgesellschaftlich zu organisieren und stellt ein Gemeingut mit unbeschränktem Zugang dar. Sowas funktioniert auch.
Allzu schnell würde ich die Hoffnung auf ein freies Netz nicht aufgeben wollen – zumindest könnten wenigstens Teile des Netzes frei von kapitalistischem Tausch (der ohnehin immer ein ungleicher ist) und staatlicher Kontrolle bleiben. Stellt sich natürlich noch die Frage, wer Zugang zu all den Daten erhält, die wir täglich bewusst oder unbewusst ins Netz stellen. Michael Seemann hat in seinem Buch „Das neue Spiel“ (orange press, 2014) herausgestellt, dass wir es nun schon seit Jahren mit einem massiven Kontrollverlust über unsere Daten zu tun haben, der auf ihrer zentralisierten Sammlung auf Sirenenservern und geschlossenen Plattformen beruht. Jeder Versuch, Daten zu kontrollieren, geht nach Seemann damit einher, dass man Daten zentralisiert sammelt (und dann missbrauchen kann). Dagegen kann es nur die Strategie geben, konsequent auf Dezentralisierung und Offenheit zu setzen. Radikale zivilgesellschaftliche Lösungen im Bereich der Netzpolitik wären hier gefordert. Wie auch immer diese Idee im Detail einzuschätzen ist, die Debatte ist eröffnet: Welches Netz wollen wir eigentlich?
Alle Macht den Nutzern!
Alle Macht den Nutzern!
von Matthias Klemm
Frank Adloff macht in seiner Replik „Facebook sozialisieren!“ auf eine zentrale Eigenschaft öffentlichen wie privaten Austauschs zwischen Personen aufmerksam: Der Austausch folgt nicht dem Motiv des Erwerbs, sondern er folgt dem Motiv des Austauschs um des Austauschs willen. Diese grundsätzliche Authentizität im digitalen Umgang miteinander sieht Adloff durch den Vorschlag Laniers gefährdet, den AutorInnen veröffentlichter Beiträge (und sei es: Klicks), die im Netz von Dritten zu deren Nutzen verwertet und wiederverwertet werden, eine Entlohnung für eben diese Weiterverwertung zukommen zu lassen. Adloff nennt das im Rückgriff auf einen klassischen Terminus die „Landnahme“ der alltäglichen Kommunikation durch den Markt. Das Laniersche Argument begreift er als weiteren Versuch, dem expansiven Kapitalismus eine neue Spielwiese zu übereignen. Die Folge wäre, mit Habermas gesprochen, die Substanz des kommunikativen Handelns, das Vertrauen in die Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Richtigkeit des Austauschs zu zerstören. Zurück bleibt die marktübliche Unterstellung instrumenteller Zwecke, sodass niemand mehr niemandem trauen kann. Deshalb schlägt Adloff den umgekehrten Weg vor: Plattformen des privaten oder teilöffentlichen Austauschs sollten „sozialisiert“ werden, d.h. „wir“ bestimmen hernach (in der Form von legitimen zivilgesellschaftlichen VertreterInnen), ob und was mit den NutzerInnenbeiträgen geschehen soll oder ob überhaupt etwas über die Beiträge hinaus damit geschehen soll. Als Beispiel dient ihm wikipedia, eine Wissensplattform ohne Gewinninteressen, die auf freiwilligen (authentischen?) Beiträgen beruht, sich selbst reguliert und die über Spenden finanziert wird.
Man kann die Überlegungen Adloffs für unterstützenswert halten, ohne die Einwände dagegen zu übersehen: Wie wird gesichert, dass NutzerInnen nicht die Plattform wechseln, also zurück in die marktorientierten Plattformen wechseln? Sozialisieren wir facebook und verbieten sicherheitshalber alle anderen? Wie funktioniert „zivilgesellschaftliche“ Kontrolle? Durch Wahlen, Gremien, Expertenrunden, Wissenschaft? Wer schützt die NutzerInnen vor den zivilgesellschaftlichen Kontrolleuren und ihrem Kontrollanspruch im Namen des Gemeinwohls? Und wer bezahlt die ExpertInnen? Einige dieser Fragen ließen sich sicherlich anhand des von Adloff gewählten Beispiels wikipedia studieren. Die einschlägigen Befunde sind jedenfalls einigermaßen ernüchternd.
Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der in meinen Augen bedenkenswert ist und der die Vorstellung freier, unverfälschter Kommunikation betrifft. Für Adloff ist der horizontale Austausch gleichsam interessenfrei und deshalb schützenswert, insbesondere vor den Zugriffen durch die Konzerne. Hier unten die guten, da oben die bösen. Wenn man aber einem interaktionistischen Verständnis von Kommunikation und Austausch folgt (siehe etwa Goffmans wunderschönes Buch „Das Indiviuum im öffentlichen Austausch“), dann wird man zugestehen, dass Kundgabe im öffentlichen wie privaten Raum immer und unter allen Umständen auch mit Selbstdarstellungsmotiven verbunden wird (ob es nun darum geht, zu „gefallen“, zu „überzeugen“, als „kompetent“ dazustehen usw.). Im Alltag sind wir hochgradig kompetent im Umgang mit diesen Selbstdarstellungsmotiven, die wir uns anhand der kulturell geformten Ausdrucksweisen erschließen (man denke an die Mode) und über die wir das Geschehen einordnen und bewerten können. Der Philosoph Michel Serres hat die horizontalen Einschätzungs- und Bewertungskompetenzen der „vernetzten Generation“ erst kürzlich in seiner ihr gewidmeten „Liebeserklärung“ besonders hervorgehoben (Michel Serres: Erfindet Euch neu!). Es kann also nicht darum gehen, ob Darstellungsmotive den Austausch um des Austauschs willen unterminieren, sondern wie ein besonderes, gleichsam mitlaufendes Erwerbsmotiv sich auf die Darstellungsweisen auswirken würde. Angesichts des Vermögens der NutzerInnen, Beiträge in ihrer Art und Weise zu unterscheiden, zu liken oder zu disliken oder einfach links liegen zu lassen, sehe ich keinen Anlass zu der Sorge, dass Darstellungsweisen, die alleine auf ein Erwerbsmotiv zurückgehen, nicht erkannt und entsprechend im Medium des Austauschs selektiert werden könnten. Mit anderen Worten würde ich auf die Kultur des Austauschs vertrauen wollen und die Fähigkeit der Nutzer, zwischen echten und „unechten“ Beiträgen zu unterscheiden. Die Forschungsliteratur der „cultural studies“, in der genau diese subversive Kraft der Nutzung aller möglicher Medien (Musik, Fernsehen, Kino, Telefon usw.) aufgezeigt wird, füllt Bibliotheken. Warum also nicht auf die lebensweltlichen Mechanismen der Selbstorganisation vertrauen?
Eine Anmerkung noch zur Dezentralisierung aller Daten: Freiheit der Daten hieße: alle mit dem technischen Wissen können als über diejenigen erfahren, die sich irgendwie digital bewegen (oder in ihren Bewegungen von anderen beobachtet und digitalisiert werden). Das ist nach meinem Dafürhalten der Schritt, die Austauschlogik des Alltags auszuhebeln. Ich stelle mir vor, wie Eltern sich fortan Transparenz über jeden Schritt ihrer Kinder verschaffen, Partner sich gegenseitig nachspionieren, Arbeitgeber noch mehr Personen einstellen, um ihr Personal zu analysieren, Krankenkassen und Inkassounternehmen nun alle Daten frei zugänglich bekommen, peers peers kontrollieren, alles frei, immer für alle. Für alle diese Beispiele gibt es Ansätze (gesammelt nachzulesen bei Sherry Turkle: Alone together), die bislang durch die im Internet existierenden Zugangsschranken gebremst werden, wobei es gerade die Schranken sind, die ein Gefühl des Voyerismus erzeugen: die Leute haben ein ungutes Gefühl bei der Nachschnüffelei. Der offene Zugang zu allen Daten eliminiert dieses Gefühl und mündet in die Demokratisierung der wechselseitigen Überwachung. Insofern kann ich mich Frank Adloffs Frage nur anschließen: Welches Netz wollen wir eigentlich?
Netzräume, mit und ohne Imagepflege
Netzräume, mit und ohne Imagepflege
von Basil Wiesse
Matthias Klemm hat in seinem Kommentar "Alle Macht den Nutzern!" die Internetkompetenz der Nutzer und damit ihre Macht gegenüber digitalen Großkonzernen betont. Laut ihm würde die Möglichkeit finanzieller Anreize das affektive Spektrum von (digitalen) Kommunikationssituationen nicht einschränken, da diese Möglichkeiten allen Nutzern offen stehen werden und diese dadurch reflexiv kommunikative Selektionskompetenzen entwickeln würden. Anhand gegenwärtiger Netzphänomene, die mit Laniers Idee assoziiert werden können und auf möglliche Folgen dieser Idee verweisen, stehe ich dieser Einschätzung allerdings zwiespältig gegenüber.
Virales Marketing, wie es gerade im Internet grassiert, baut auf dem Versuch auf, ein Gefühl kommunikativer Authentizität zu evozieren. Die Folgen lassen sich auf Plattformen beobachten, in denen die Nutzerbasis über die Existenz von „undercover“-Marketern informiert ist oder eine solche vermutet: Diskussionsteilnehmer werden abgewürgt, jeder verdächtigt jeden, und im Zweifelsfall wird die Unterhaltung abgebrochen. Warum nun sollte es nun in Laniers "two-way-Internet" anders sein? Die Möglichkeit finanziell motivierter Kommunikation würde andere, als "authentisch" eingestufte Kommunikationsmotive emotional aufwerten, und diese Aufwertung lässt sich gewinnbringend zu Nutze machen. Selbst wenn keiner der Nutzer finanzielle Interessen innerhalb einer Kommunikationssituation hätte, kann sich deren bloße Möglichkeit deshalb auf die Form der Kommunikation niederschlagen und in Verdachtszuschreibungen ausarten. Wenn jeder das Potenzial hätte, sein eigener Marketer zu sein, wäre es also nicht auszuschließen, dass sich dieses momentan nur in bestimmten Foren beobachtbare Verhalten massiv ausbreitet.
Hier kommt nun Klemms Verweis auf die Selbstdarstellungskompetenzen der Nutzer ins Spiel. Das Argument gegenüber obigem Punkt wäre also, dass, wenn jeder sich ständig selbst vermarktet - was nach Goffman ja ohnehin bereits der Fall ist - könne mit der Zeit relativ problemlos zwischen "echter" und "unechter" Kommunikation differenziert werden. Auch das lässt sich bereits beobachten, und zwar auf Plattformen, die es Nutzern erlauben, Beiträge anderer Nutzer positiv oder negativ zu bewerten, wobei jeder Nutzer einen "Punktestand" an entsprechenden Bewertungen hat: Hier wird mit dem Vorwurf, mit seinen Beiträgen ja nur Punkte sammeln zu wollen, weitestgehend humorvoll umgegangen, ohne sich dadurch vom "eigentlichen" Gesprächsthema ablenken zu lassen. Jedoch bleibt trotz Ironisierung das Punktesammeln als solches ein zentrales Motiv, überhaupt erst an bestimmten Diskussionen teilzunehmen. Wie im Alltag (zumindest aus Goffmanscher Perspektive) werden Äußerungen und Tätigkeiten also mit einem gewissen Maß an Bedacht ausgeführt oder unterlassen, um nicht negativ sanktioniert zu werden (bzw. hier: um den eigenen Punktestand nicht zu gefährden).
Durch die umfassende Bewertungsmöglichkeit eigener Aussagen und Tätigkeiten - und das ist, was Laniers Idee impliziert - fehlt jedoch die Möglichkeit, sich eben nicht ständig um sein eigenes Image (oder seinen Profit) sorgen zu müssen. An diesem Punkt sollte meines Erachtens über Goffman hinausgegangen werden: Dieser interessierte sich vor allem für die Vermeidung drohender Beschämung in sozialer Interaktion, weniger aber für positiv konnotierte soziale Emotionen wie sie mit dem Aufgehen in der Situation oder im Anderen einhergehen. Ein entlohnendes Internet könnte gegebenenfalls on- wie offline Räume verdrängen, in denen sich, salopp gesagt, die Leute auch mal ein wenig daneben benehmen dürfen. Davon wären nicht nur Praktiken gemeinsamer Enthemmung betroffen (die sicherlich auch und gerade im Internet kuriose Formen annehmen können); auch die ungeplanten Resultate spontanen kreativen Experimentierens könnten hierdurch eine Einschränkung erfahren. In Laniers Utopie wäre zwar gerade ein solches Experimentieren und Schaffen von Neuem besonders erstrebenswert (und profitabel). Doch bleibt die Frage, ob nicht das Wissen um die Möglichkeit, Profit aus dem eigenen Handeln schlagen zu können, die Bereitschaft hemmt, ein Stück Vertrauen in Situationen mit ungewissem Ausgang zu setzen.
Damit soll aber nicht der Teufel an die Wand gemalt werden: Es ist davon auszugehen, dass solche Freiräume erhalten bleiben oder von den Nutzern selbst neu geschaffen werden. Wenn wir bei Lanier verbleiben, gegebenenfalls verknüpft mit Mechanismen, die kommerzielle Wiederverwertung und damit die Möglichkeit einer Entlohnung unterbinden (wie es hinsichtlich der Wiederverwertung auch bereits populäre Browsererweiterungen zum Teil ermöglichen – wenn auch ohne Einverständnis der Unterbundenen). Hier gelangen wir zu Frank Adloffs Vorschlag der Sozialisierung von zentralen Kommunikationsplattformen. Den Einwand Klemms dazu würde ich teilen: Deren Verdrängung durch kommerziell orientierte Konkurrenz ist nicht unwahrscheinlich, wenn man sich an den Untergang vergangener digitaler Quasi-Monopole erinnert. Eine Lösung bestünde in einem gemeinsamen Protokollstandard für soziale Netzwerke, der eine Pluralität an kompatiblen Plattformen ermöglichen würde - ähnlich, wie auch wir jetzt mit Kunden verschiedener Telefongesellschaften telefonieren können. Hierdurch könnten Nutzer selbst entscheiden, ob und wie ihr (Netz-)Verhalten weiterverwendet werden kann, ohne sich und ihren Bekanntenkreis Anbieterabhängig fragmentieren zu müssen (sondern stattdessen bei Bedarf nach eigenen Wünschen fragmentieren zu können).
Klemms zweiter Einwand, die Gefahr einer mangelnden Kontrolle der Verantwortlichen, ist damit jedoch nicht vom Tisch: Wie wäre die Einhaltung zivil- und datenschutzrechtlicher Standards eines „Meta-Facebooks“ sichergestellt? Hier könnten bestehende Strukturen weiterhelfen, indem es beispielsweise durch das World Wide Web Consortium (W3C) als offener Standard durchgesetzt wird. Die Aktivitäten des W3C geschehen nicht im Dunkeln, sondern werden beispielsweise von anderen Nichtregierungsorganisationen, die sich ein freies Internet auf die Fahnen geschrieben haben (etwa die Electronic Frontier Foundation oder der Chaos Computer Club), aufmerksam verfolgt. Deren Aufklärungsarbeit wiederum erreicht über engagierte Blogger früher oder später netzpolitisch interessierte Nutzer. Das Interesse an Netzpolitik dürfte dabei, so zumindest meine Vermutung, mit dem voranschreitenden Zurücktreiben der Grenze zwischen On- und Offline (beispielsweise durch 3D-Drucker oder augmented reality) noch weiter ansteigen.