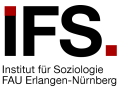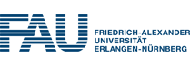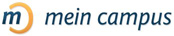Hauptseminar
Geschlechter(un)gleichheit in der Arbeitswelt
Trotz erkennbarer Fortschritte bei der Angleichung der Geschlechter sind Frauen häufiger prekär beschäftigt, erzielen im Durchschnitt geringere Einkommen und haben eingeschränktere Aufstiegschancen als Männer – woran die kontrovers geführte Debatte um eine „Frauenquote in Top-Führungspositionen“ anknüpft. Fragt man nach den Ursachen für diese strukturellen Ungleichheiten, geraten geschlechtertypische Berufswahl, familiale Arbeitsteilung, männlich geprägte Organisationsstrukturen oder eine im internationalen Vergleich wenig fortschrittliche Familien- und Arbeitsmarktpolitik in den Blick.
Vergleichende Analysen von Bildung und Bildungssystemen
Das von der OECD initiierte Programme for International Student Assessment (PISA) und der europäische Bologna-Prozess zur Schaffung eines europäischen Hochschulraumes haben die Transformation des deutschen Bildungssystems in den letzen Jahren massiv beschleunigt. PISA und Bologna lassen sich als Stützen einer neuen wissenschaftlich-technischen Gouvernance von Bildung begreifen. Ihr entscheidendes Verfahren, das im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung steht, bildet der Vergleich nationaler Bildungssysteme entlang global definierter Bildungsstandards.
Qualitative Methoden
Das Seminar soll einen Überblick über die divergierenden Analyserichtungen der qualitativen Sozialforschung verschaffen. Neben der Auseinandersetzung mit den methodologischen Differenzen der unterschiedlichen Forschungsansätze liegt der Fokus auf der Vermittlung von Fähigkeiten in der praktischen Anwendung der verschiedenen interpretativen Paradigmen.
Examenskurs
In dieser Veranstaltung sollen die Studierenden des Grund-, Haupt-, Real-, Gymnasial- und Berufsschulschullehrsamtes auf das Examen vorbereitet werden, indem die für die Prüfung wesentlichen Themenbereiche behandelt werden.
Eine Teilnahme wird allen Studierenden dringend empfohlen, die demnächst ihr Examen ablegen wollen.
Sozialstruktur I
Im Mittelpunkt stehen die wesentlichen sozialstrukturellen Entwicklungen seit Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945. Das Seminar überspannt die Zeit des Kaiserreichs, die beiden Weltkriege, die Weimarer Republik und den Nationalsozialismus, wobei – vor dem Hintergrund der politischen, sozialen, demographischen, kulturellen und ökonomischen Prozesse – ein besonderes Augenmerk dem Wandel von Familie, der Geschlechterverhältnisse, des Bildungswesen und der -chancen und der Entwicklung der sozialen Ungleichheit gelegt wird.
Sozialisation und (De)Konstruktion der Geschlechtsidentität
Geschlecht zählt zu den zentralen Strukturkategorien der Gesellschaft. Lebenschancen (Beruf, Einkommen, Status) sowie Identitätsangebote und –zumutungen werden über Zuordnung und Zugehörigkeit zur männlichen oder weiblichen Geschlechtskategorie vermittelt.
Partizipation in Großgruppen
Seit Mitte der 90er Jahre kommen auch im deutschsprachigen Raum verstärkt Beteiligungsverfahren für große Gruppen zum Einsatz. Sie unterstützen Prozesse der Organisationsentwicklung in Wirtschaftsunternehmen und Organisationen, wie auch politische Planungsprozesse in Städten und Gemeinden.
Moderne und Individualisierung
In diesem Seminar wird der Zusammenhang zwischen der Geschichte der Moderne und dem Prozess der zunehmenden Individualisierung behandelt. Dabei werden zum einen die realen Entwicklungsprozesse untersucht. Zum anderen werden prominente Theorien diskutiert, die diesen Zusammenhang darzustellen und zu erklären versuchen.
Theorien gesellschaftlicher Modernisierung
Wie lässt sich gesellschaftliche Entwicklung begreifen? Als Modernisierung. So jedenfalls lautet die Antwort einer – breit vertretenen – soziologischen Position. Was aber genau unter Modernisierung zu verstehen ist und wie sich Entwicklung begrifflich fassen lässt, wird recht unterschiedlich beantwortet. Im Seminar werden gegenwärtige Theorien gesellschaftlicher Modernisierung vorgestellt und diskutiert.
Soziale Ungleichheit
Gesellschaftlich wichtige Ressourcen wie bspw. Kapital, Macht, Bildung, Einkommen sind zwischen verschiedenen sozialen Gruppen einer Gesellschaft ungleich verteilt. Welche Erklärungen und Deutungen gibt es für die soziale Ungleichheit in der Sozialstruktur moderner Gesellschaften? Zur ‚Beantwortung’ dieser Frage sollen in dem Seminar klassische und aktuelle Theorien über soziale Ungleichheit gelesen und diskutiert werden.